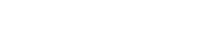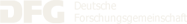Ihr gehaltvoller Brief, mein hochgeehrter Herr und Freund, blieb nach meiner gewöhnlichen Saumseligkeit lange unbeantwortet. Unterdessen habe ich ein Buch gesendet, das rechnen Sie mir wohl für einen Brief an. Überhaupt ist es mit dem Schreiben ein mühseliger Notbehelf. Kommen Sie denn gar nicht einmal an die schönen Ufer des Rheines? Etwa in den nächsten Herbstferien? Dann finden Sie mich gewiß hier, und zu allem was mein Haus und meine Bibliothek vermag, sind Sie bestens eingeladen.
Mit Parjanyas schalten Sie nach Belieben, wie mit allen meinen etymologischen Schnurrpfeifereien. Bei Fairguni treffen wir zusammen. Ich hatte es ganz vergessen, aber heute sehe ich zufällig, daß ich in Zahns Glossar das Sartische Wort schon vor Jahren mit einem Fragezeichen an den Rand geschrieben habe. Von Parjanyas weiß ich keine befriedigende Ableitung; so ist es mit manchen Götternamen. Wilson hat auch paryanyas. Das könnte pari-anyas bedeuten, περὶ ἄλλος, rings herum anders, von dem Wechsel der Jahreszeiten. Die Corruption aus y halbvocal in j (das Italiänische ge) die wir wohl in den heutigen Mundarten kennen, müßte dann schon sehr alt seyn. Die Indischen Grammatiker zählen es unter die durch Uńâdi-Affixe gebildeten Wörter, d. h. sie wissen keine regelmäßige Ableitung zu finden. Im Amara Cosha steht es unter den vieldeutigen Wörtern mit nur zwei Bedeutungen, eine Donnerwolke und Indras. Aber der Amara Cosha ist keinesweges vollständig. In der Bhag.[avad] G.[îtâ] steht parjanya ausgemacht für den befruchtenden Regen. Das Verhältniß der Konsonanten zu Fairguni wäre wohl richtig. Freilich sollte für das j, welches immer einem ursprünglichen g gleich gilt, im Gothischen k stehen; aber wir müssen wohl annehmen, daß das Zusammentreffen zweier Konsonanten nicht selten die Lautverschiebung sistirt hat.
Ich finde in meinem Glossar gleich daneben eine andre Zusammenstellung angemerkt: Fairhvus Skr. pârçva. Ich bezeichne der Anschaulichkeit wegen durch ç das palatale ś, wofür im Lateinischen und Griechischen gewöhnlich k, im Gothischen h steht. pârçva, latus, abgeleitet von parçu, die Rippe; gleichsam die Gesamtheit der Rippen. Die Bedeutung ist wunderbar verschieden, die Identität der Elemente nach den Gesetzen der Lautverschiebung vollkommen.
Ebenso ist es mit atathni, wobei Reinwald an das Persische adad gedacht hat. Lassen sagt mir, Sie hätten auch snskr. âditya, sol, angeführt. Die Consonanten sind ganz in der Ordnung: aus der media wird im Gothischen tenuis, aus der tenuis, – adspirata; ĭ für ă hat auch nichts auf sich; aber das ā fällt hinderlich. āditya soll ein Patronymicum seyn, von ădĭtĭ. Diese ist die Mutter der Götter, wie im Gegensatz diti der Ungötter. Wenn man die allegorische Deutung gelten läßt, so wäre aditi, die personificirte Helle, der Tag, diti die Nacht, atath-ni ein Collectivum von Tag.
Die mythologischen Übergänge sind wichtig, wegen der Geschichte der Religionen. Nur muß man vorsichtiger zu Werke gehn als S. W. Jones, der jedoch zwei bis 3 richtige Bemerkungen hat.
Man trifft auf wunderbare Spuren, um so unverdächtiger, je weniger man sie erwartet hatte. Wir sehen jetzt schon, wiewohl noch wie durch einen Nebel, daß die Altpersische und die Brahmanische aus Einer Quelle her geflossen, daß Zoroaster als ein Reformator gegen die einreißende Vielgötterei aufgetreten.
Denken Sie, letzthin finde ich im Râmâyańa, in einer Beschreibung aller Länder des Erdbodens, einige von den Lügen des Ktesias wieder: namentlich die Einfüßigen Menschen, und die Ohrigen, wie sie der Vf. des Herzog Ernst nennt: Karńaprâvâraka, wörtlich die Ohren-bemäntelten. Ktesias war also nicht Erfinder, sondern fehlte nur darin, daß er Erzählungen, aus fabelhaften Büchern geschöpft, für geographische Wahrheiten nahm. War schon unter den letzten Achaemeniden einiger litterarische Verkehr zwischen Persien und Indien? Unter den Sassaniden ist es nicht zu läugnen.
Silvestre de Sacy hat von meinen Réflexions Gelegenheit genommen, mir sein Mémoire zu senden, worin er die Erfindung von 1001 Nacht ausschließlich den Arabern vindicirt. Hierauf ein ausführliches Schreiben von mir, worin ich ihm unter andern die zweite Erzählung der Einleitung, von dem Verständnisse der Thiersprachen, nach ihren Grundzügen im Râmâyańa nachgewiesen habe. Die Persischen und Arabischen Interpolationen läugne ich nicht nur nicht, sondern ich behaupte sie, und glaube sie bestimmt nachweisen zu können. Das Indische erkennt man an der Dämono- und Thaumatologie, an Form und Geist der Erfindung, an dem durch die Verkleidung hindurchblickenden Costum, pp. Da der alte Herr, weil er den Widerspruch nicht liebt, meinen Brief hinter den Spiegel gesteckt zu haben scheint, so werde ich ihn nächstens drucken lassen.
Ich schreibe vom hundertsten ins tausendste: Sie müssen schon so vorlieb nehmen, sonst käme es gar nicht zu Staude.
Warum ich mich mit Toto und Totila nicht begnügen will? Weil der Mann aus dem Geschlechte der Balthen war, und also einen Heerführer und Fürstennamen haben mußte. Theodorich war aber in diesem Geschlechte üblich. Toto und Totila sind nicht weiter von Theodorich entfernt, als Fritz und Fritzchen von Friedrich, lange nicht so weit als Rucco von Ragnemundus, welches nun einmal feststeht. Die Frage über die uralten ὑποκοριστικά wird wichtig für ein deutsches Onomasticon, welches zu schaffen wohl Noth thäte. Mein Bruder hat die Bemerkung gemacht, daß die wirklich onomatopoetischen Wörter sich durch Wiederholungen kundgeben, z.B. murmur, susurrus, turtur, cuculus. Ich meyne, es wäre oft auch so mit den vertraulichen Abkürzungen der Namen Gogo, Mumustus, Pipin, Poppo etc. Wenn Sie von allen diesen Etymologien schaffen sollen, werden Sie in Noth gerathen.
Bei der Stelle in den Nibelungen sind wir, wie ich sehe, nicht einmal über das Material einig. Sie lesen jāriā; das gäbe einen lahmen Vers. Ich las immer jăríă.
Es ist um die Sprachvergleichung eine schöne und cüriöse Sache, aber durch die Überschwemmung mit unreifen Schriften wird sie mir zum Greuel. Wenn ich Ihre Grammatik zur Hand nehme, so erwacht meine ganze Lust daran wieder, ich bin dann in Gefahr, die gegenwärtige Arbeit zu versäumen, und Hr. Lassen pflegt dann auf meine Bitte das verführerische Buch in meine Bibliothek so wegzustellen, daß ich es nicht wiederfinden kann.
Die Juristen haben einen unglaublichen Respect vor Ihnen bekommen. Es ist aber doch eine harte Zumuthung daß die armen Leute alle die Sprachen wissen sollen, da sie meistens nicht einmal gründlich Latein wissen. Auch mir, ich will es nur gestehen, wären Übersetzungen sehr willkommen gewesen.
Sie sagen einige vermittelnde Worte über mein Verhältniß mit Bopp. Er hat mir allerdings sehr üble Streiche gespielt, aber das darf auf das Urtheil über seine wissenschaftlichen Leistungen keinen Einfluß haben, und hat es auch bei mir nicht gehabt. Mich verdroß die kleinigkeitskrämerische und pedantische Richtung, welche er dem Studium des Sanskrit gab. Ich hatte es unternommen, um die herrlichen Dichtungen und die Lehren der alten Weisen kennen zu lernen, auch in der Hoffnung neue Aufschlüsse über die Vorwelt und den Gang des menschlichen Geistes zu erlangen. – W. v. Humboldt könnte ich hier wohl nicht als einen unparteiischen Schiedsrichter anerkennen. Bopp ist sein amanuensis, in Berlin sein Geschöpf, und Humboldt hat ihn ja selbst in das Unwesen mit der barbarischen Wortzerreißung hineingestoßen. Der Eifer, womit H.[umboldt], ein Mann von so umfassendem Geist, diese Sache betrieb, wäre mir unbegreiflich, wenn ich nicht wüßte, daß er im Sanskrit immer nur ein Anfänger geblieben ist. Ich habe damals mit Humboldt Briefe darüber gewechselt, seinen Satz: in allen gebildeten Sprachen habe man große Sorgfalt auf die Worttrennung gewendet, widerlegt, und gezeigt, daß es nach Beschaffenheit der Sprachen verschieden war und seyn mußte: alles vergeblich! Nun, im Vendidad steht nach jedem Wort freilich ein Punkt; aber wie wäre es im Sanskrit möglich, bei den unaufhörlichen Synalöphen?
Sie werden schon gesehen haben, daß ich in den Réflexions säuberlich mit Bopp verfahren bin. Dem Auslande gegenüber schickte es sich nicht anders. Er scheint sich denn auch wieder annähern zu wollen, und hat mir sein Zendisches geschickt. So nenne ich es mit Recht, weil in allem übrigen eben nichts neues ist. Aber dieser Artikel ist gründlich gearbeitet, und leicht das beste was er noch ans Licht gebracht. Mich ergötzt sein Wesen mit dem Pânini. Lassens nachdrückliche Zurechtweisung hat so viel gewirkt, daß er sich den Schein giebt, als sey er auch in dem alten Grammatiker nicht unbewandert. Aber er versteht ihn nicht zum besten, und schneidet Gesichter dazu, gerade wie Pistol, als ihn Fluellen gezwungen hat, Knoblauch zu essen: „Ich essʼ, und essʼ, und fluche.“
Da beim Zend die Sprachvergleichung ein Hauptmittel zum Verständniß zu gelangen, so muß man damit anfangen. Hier ist also Bopp ziemlich in seinem Fach. Zur Auslegung und vollends zur Kritik der Texte hat er einmal kein Talent.
Die Präpositionen als Casuszeichen hat B.[opp] nun aufgegeben: desto besser! So spart er uns die Widerlegung, die zwar leicht genug gewesen wäre. Nun müssen es aber die Pronomina seyn, die bei ihm mit allen möglichen Brühen aufgetischt werden; da weiß ich nicht ob wir nicht aus dem Regen in die Traufe kommen. Überhaupt ist die Agglutination eine mechanische Hypothese, die am Ende nichts erklärt. Denn wenn man z. B. eins, das Verbum substantivum, zu conjugiren wußte, so konnte man auch alles conjugiren, und brauchte nicht zu leimen. Das V.[erbum] Substantivum ist aber, als solches, das späteste aller Verba. Mit den wahrhaft historischen Agglutinationen z. B. dem Futurum der Romanischen Sprachen ist es ganz etwas anders.
Was sagen Sie zu Hrn. Lachmanns Artigkeiten gegen mich? Ich enthalte mich jeder Bemerkung, da er Sie seinen Freund hat nennen dürfen. Überdieß bin ich für die Preßfreiheit. Wenn der Autor sich keinen Zwang anzuthun braucht, so kommen seine Gesinnungen, seine Absichten, und besonders seine gesellschaftlichen Sitten um so deutlicher zum Vorschein. Mir wäre es recht, wenn er auch sein Porträt beigefügt hätte.
Man sagt mir, ich sei auch von Hammer heftig angegriffen, im Foreign quarterly Review, und von dem wild gewordenen Juden Heine in Paris. Ich hätte viel zu thun, wenn ich das alles lesen, oder gar etwas darauf erwiedern sollte.
Leben Sie recht wohl, und lassen Sie mich bald erwünschte Nachrichten hören. Zwei Zeilen, des Inhalts, daß Sie uns zu besuchen gedenken, sollen für den längsten Brief gelten.
Ganz der Ihrige
A. W. v. Schlegel