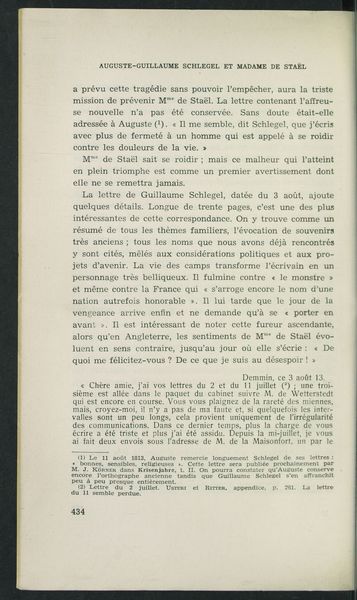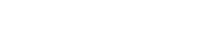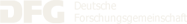Liebe Freundin!
Ihre Briefe vom 2. und 11. Juli habe ich erhalten. Ein dritter befindet sich in dem Kuriergepäck Herrn von Wetterstedts, das noch unterwegs ist. Sie beklagen sich darüber, daß ich Ihnen so selten schreibe, aber glauben Sie mir: es ist nicht meine Schuld, und wenn einmal die Zwischenräume etwas lang sind, so liegt das lediglich an der Unregelmäßigkeit der Verbindungen. In der letzten Zeit bedeutete zudem jeder Brief an Sie die Erfüllung einer traurigen Pflicht: trotzdem nahm ich sie immer wieder gern auf mich. Seit Mitte Juli richtete ich zwei Sendungen für Sie an die Adresse des Herrn de la Maisonfort: eine durch den Maler Wallis und eine über die Bankiers. Ich harre noch immer mit angsterfülltem Herzen Ihrer Antwort auf die traurige Nachricht, aber ich werde noch vierzehn Tage warten müssen, denn frühestens heute können Sie sie erhalten haben. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich den guten, zärtlichen Brief sehe, den Albertine an ihren unglücklichen Bruder einen Tag vor seinem Tode geschrieben hat.
Ich habe lieber eine traurige Reise nach Rostock und Doberan gemacht, als den Prinzen nach Berlin begleitet, wo ich eine Woche lang glänzend aufgenommen worden wäre. Indessen fürchtete ich, nach Beendigung des Waffenstillstandes für eine Privatreise keinen Urlaub mehr bekommen zu können – dann aber wären vielleicht schon einige Erinnerungen geschwunden gewesen. Alle notwendigen Erkundigungen wegen des Grabes habe ich eingezogen und werde sie August übermitteln. Ich glaubte, mit mehr Festigkeit an einen Mann schreiben zu können, der dazu berufen ist, sich gegen die Schmerzen des Lebens zu stählen. Ich habe Herrn Björnstjerna noch in Doberan getroffen; er hat mir mehrere Einzelheiten anvertraut. – Ich habe mit ihm den Kampfplatz besucht – er ist für alles andere eher als für eine so blutige Szene geschaffen: es ist ein kleines Rund inmitten eines reizend daliegenden Gehölzes auf einem waldigen Hügel, der der Buckenberg heißt; er liegt malerisch gegenüber der Einfriedigung eines alten Klosters, durch das man in das Städtchen Doberan kommt. Eigentlich ist dieser Platz wie geschaffen für stille Vergnügungen und um Krieg und Sorgen zu vergessen; das Land ist fruchtbar und freundlich – eine Stunde Weges von dort ein wundervoller Strand, wo man baden kann. Ländliche, aber elegante Wohnungen, eine ungezwungene Geselligkeit, Tanz, Musik und Schauspiel, die dem Müßiggänger immerhin erträglich scheinen mögen. Unser unglücklicher Albert war nur auf das Vergnügen versessen, das verhängnisvoll für ihn werden sollte. Jeder erzählt hier eine Prophezeiung Admiral Hopes, der, als er Albert in seiner leidenschaftlichen Art spielen sah, sagte: ›Dieser junge Mensch wird vorzeitig ein unglückliches Ende nehmen.‹ Ich habe diesen tapferen Mann nicht wiedergesehen; er war in Warnemünde, wo sein Geschwader liegt – aber man sagte mir, dies Unglück habe ihn tief getroffen; er mache sich bittere Vorwürfe, daß er nicht versucht habe, Albert mit fortzunehmen. Man quält sich in Gedanken ab, wie es wohl möglich gewesen wäre, eine solche Tragödie zu verhindern. Ich schrieb Ihnen schon, daß ich außerstande war, Alberts Aufenthalt in Doberan zu verhindern. Er hatte sich wohl gehütet, mir zu sagen, daß er den Prinzen um die Erlaubnis dazu angehen wollte. Nachdem er sie einmal erhalten hatte, wäre es vergeblich gewesen, ihn davon abbringen zu wollen. Der Urlaubsschein, der ihm ganz regulär vom Regimentsstab ausgefertigt war, befindet sich unter seinen Papieren. Es scheint, daß der Prinz ihm seine erste Bitte nach seiner leichten Verbannung auf Rügen nicht hat abschlagen wollen. Übrigens hatte er mit ihm sehr ernst über das Spielen geredet und ihm versprochen, ihn im nächsten Monat zum Leutnant zu machen, wenn er sich gut aufführe. Albert sagte mir, daß er den Prinzen darum bitten würde; ich versuchte, es ihm auszureden, weil erst zu kurze Zeit verflossen sei, seitdem er ernste Unzufriedenheit erregt hätte. Aber der Prinz bewies durch sein Versprechen, daß er seiner Tapferkeit Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte, wiewohl er seine Unbesonnenheit tadelte. Ich glaubte zu wissen, daß man in Doberan spielte, aber es gab dort schließlich auch unschuldige oder weniger gefährliche Vergnügungen, und ich dachte, wenn man ihn zwänge, nach Stralsund zurückzukommen, würde man ihn in Wut bringen und Müßiggang und Langeweile würden ihn dann zu tausend Torheiten treiben. Inzwischen habe ich erfahren, daß er auch in Stralsund Möglichkeiten gefunden hat, erhebliche Summen bei Gesellschaftsspielen zu verlieren. Er hatte mir die Wahrheit verheimlicht und erklärt, in Hamburg habe er nur ganz unbedeutend gespielt und dabei hätten sich Gewinn und Verlust die Waage gehalten. Wahr ist aber, daß er bedeutende Schulden beim Spiel gemacht hat, und einer der Gründe, die ihn veranlaßten, nach Doberan zu gehen, war vielleicht, daß er gewinnen wollte, um seine Schulden bezahlen zu können. Aber als er dann im Anfang viel gewonnen hatte, bezahlte er sie doch nicht, wie es Spieler gewöhnlich tun. Schließlich ist die Art, wie man in Doberan spielt, weniger gefährlich als alle anderen, vorausgesetzt, daß man seiner Leidenschaften einigermaßen Herr ist. Denn wenn junge Leute unter sich oder mit Unbekannten spielen, sind sie natürlich der Gefahr ausgesetzt, einem Betrüger in die Hände zu fallen, und Gelegenheit zu Zänkereien gibt es jeden Augenblick. Die Bankhalter in einem öffentlich autorisierten Betrieb dagegen streiten sich niemals; sie bewilligen keinen Kredit, aber sie zahlen sofort mit der größten Kaltblütigkeit aus, wenn sie verlieren; so kommt es zu gar keiner direkten Berührung mit den Gegenspielern. Das größte Unglück, das zu befürchten war, bestand also darin, daß Albert die Summe verlor, die er bei sich hatte, und daß er ohne Geld nach Stralsund zurückkam; das hätte ihn vielleicht Entbehrungen gekostet und ihm Vorwürfe eingetragen. Es gibt im Menschenleben eben ein Schicksal oder vielmehr eine Vorsehung: seine Stunde war durch die verhängnisvolle Leidenschaft bestimmt, die Ihre Strenge seit langer Zeit vergeblich versucht hatte zu mildern. Und dann hatte er ein unbegrenztes Vertrauen auf seine Kraft und seine Geschicklichkeit. Wenn er nur im geringsten gegen seinen Gegner auf der Hut gewesen wäre, hätte er nicht so getroffen werden können – er hat sich, sozusagen ohne sich zu verteidigen, töten lassen.
Während dieses einen Tages, den ich in Doberan verbrachte, habe ich den Arzt nicht sprechen können; ich hätte ihn gern nach Alberts letzten Worten gefragt. So habe ich einen Bekannten damit beauftragt, es zu tun. Aber ich bezweifle, daß der Arzt etwas weiß: Er ist ein alter Mann, der sehr erschrocken war, daß man ihn zwang, dabei zu sein, und während der zwei Minuten, die Albert noch lebte, werden die vergeblichen Versuche, die er machte, um das Blut zu stillen, ihn auf nichts anderes haben achten lassen. Ich halte mich also an das, was Graf von Schwerin mir sagte. Nach dem Bericht der anderen Augenzeugen hat er mit den letzten Anstrengungen seiner brechenden Stimme nach Ihnen gerufen – das war sein Sterbegebet!
Man kann wohl sagen, daß er aufrecht stehend gestorben ist; die Erde diente erst seiner kalten Leiche als Ruhestätte. Festigkeit gegen Gefahr und Schmerz, die kennzeichnend für ihn war, hat er so auch in seinen letzten Augenblicken nicht verleugnet. Er hat, wie es scheint, als er getroffen war, noch den Versuch gemacht, zum Hieb auszuholen, bevor ihm der Säbel aus der Hand fiel.
Er sagte mir vor einiger Zeit, er glaube nicht, daß er noch lange zu leben habe. Nach meiner Erinnerung (aber ich bin dessen nicht ganz sicher) habe ich ihm geantwortet: ›Wenn das der Fall ist, weshalb stellen Sie sich dann nicht ernster zum Leben ein?‹
Wieviel Voraussetzungen zum Glück sind hier vergeudet! Eine Mutter wie Sie! Eine Schwester wie Albertine! Ein Bruder wie August! Alle Erleichterungen, die Geburt und Vermögen gewähren können! Der Kronprinz als Vorgesetzter und Führer auf einer ruhmvollen Laufbahn und der herrlichste Krieg vor ihm! Wäre er vor dem Feinde gefallen, so wäre sein Name zweifellos ebenso unsterblich geworden wie der Ihre.
Sicherlich schonte er sein Leben nicht – auch das war ein schöner Zug an ihm. Davon zeugt auch eine Episode, die ich nicht von ihm selbst habe: Es handelte sich in Hamburg darum, die Schanzwerke des Feindes auf dem anderen Elbufer zu rekognoszieren. Albert setzte sich ganz allein in ein Boot und gelangte bis unter die feindlichen Batterien. Die Franzosen waren zuerst ganz verblüfft über diesen Wagemut, dann schossen sie auf ihn, ohne ihn zu treffen, und er sah ihnen zu, ohne sich im mindesten aufzuregen. Schließlich kehrte er rudernd zu seinen Truppen zurück.
Der Herzog von Mecklenburg, ein braver Mann, der nicht viel Umstände macht, dessen Beispiel aber trotz seines Alters die jungen Leute mehr bei ihren Torheiten ermutigt als sie im Zaume hält, hat mir sein lebhaftes Bedauern über Albert als einen prächtigen Kameraden in fröhlichen Stunden ausgesprochen; er hat mir auch davon geredet, wie sehr seine Garde an Albert hinge, die sich gleichzeitig mit ihm in Hamburg ausgezeichnet hat. Der Erbprinz und die Erbprinzessin haben tiefsten Schmerz über diesen verhängnisvollen Schicksalsschlag und eine wahrhafte Teilnahme an Ihrem Schmerz bekundet. Viele andere ebenso. Sein Begräbnis fand mit ausgesuchter Feierlichkeit und allen Ehrenbezeigungen statt.
Ich muß mich jetzt von diesem traurigen Vorfall freimachen; das Leben geht weiter seinen Gang – es stellt notwendigerweise neue Anforderungen an uns. Wir müssen es ertragen und seiner Herr werden. Liebe Freundin! Sie werden jetzt sehr einsam sein, wo Ihre Gedanken an diesem Verlust hängen, wo August abreist und Sie noch dazu in einem unbekannten Lande weilen. Indessen ich weiß noch nicht, wann ich Sie in England werde wiedersehen können. So lange es noch Hoffnung auf dieser Seite des Meeres gibt, muß ich hier bleiben.
In wenigen Tagen werden wir wissen, ob es Krieg oder Frieden geben wird. Man bereitet sich in der Erwartung auf den Krieg vor. Seit acht Tagen ist alles in Bewegung und rückt vor. Der Prinz hat seine Reise in der ausgesprochenen Absicht verlängert, die ganze Linie zu inspizieren. Die Eroberungen Lord Wellingtons [in Spanien] und die Haltung Österreichs und Schwedens müssen auf die Verhandlungen gewaltig einwirken. Ich kann mir nicht denken, daß unter so günstigen Umständen die Verbündeten so schwach sein könnten, einen anderen als einen allgemeinen Frieden zu schließen, den man wirklich gut zu nennen vermöchte. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht verhehlen, daß Bonaparte trotz seiner Veranlagung hartnäckig darauf los zu wüten, klug genug ist, zu geeigneter Zeit sich zu bescheiden, und daß der Augenblick für ihn kritisch ist. Übrigens versichert man, daß Berthier und seine übrige Umgebung ihm dauernd Frieden predigen. Sie sind durch Rückschläge und Alter weich geworden. Aber wie nun auch die Bedingungen lauten mögen, ich werde nie daran glauben können, daß der Friede wirklich gut wird, denn ich kenne die Krötengabe dieses Ungeheuers, abgehauene Tatzen nachwachsen zu lassen. Wenn der Krieg wieder beginnt, hat mir der Prinz gesagt, bliebe ich immer in seinem Hauptquartier und würde viel zu tun haben. Bis jetzt habe ich nur einige diplomatische Briefe, ein paar Übersetzungen und eine politische Streitschrift gegen Dänemark verfaßt (die ich Herrn von Münster geschickt habe und Ihnen deutsch oder in einer französischen Übersetzung senden werde). Wird aber Friede geschlossen, muß ich eine Reise, mindestens nach Berlin machen, um literarische und andere Verabredungen zu treffen, bevor ich meinem Vaterland für lange Zeit Lebewohl sage. Darnach werde ich um Urlaub für eine Reise nach England bitten. Sie aber bitte ich, sich um keine Gnadenerweise für mich zu bemühen, bevor ich da bin; alles regelt sich besser in meiner Gegenwart. Ich weiß, daß Herr von Münster dem Prinzregenten [von England] einen Brief von mir vorgelesen und daß man sich lobend über ihn ausgesprochen hat – dies unter uns! – Ich habe ganz große Pläne für Werke, die ich schreiben will: was kann man Besseres tun, wenn man nicht handeln kann? Man muß doch versuchen, irgend eine leuchtende Spur seines dunklen Erdendaseins zurückzulassen. Mehrere unter meinen Plänen beziehen sich auf nationale Fragen; man muß deshalb hoffen, daß Deutschland so vollständig zu sich selbst kommt, daß man ein Vergnügen darin finden kann, ihm seine Schriften zu widmen.
Glück erhoffe ich nicht mehr – liebe Freundin! ich zweifle nicht an Ihrer Freundschaft – aber Sie haben selbst oft dem Dichter zugestimmt, der die Freundschaft als einen schwachen Rückhalt anderen Verlusten gegenüber bezeichnet. Ich trage Wunden in meinem Herzen, die nicht heilen – auch Sie haben mir eine solche geschlagen – meine Jugend ist verloren, mein Leben verfehlt, und ich stehe vereinsamt auf der Schattenseite des Daseins. Die Liebe hat mich verraten, die Poesie verläßt mich, die äußeren Gegenstände verdunkeln sich vor meinen Augen: es bleibt mir nichts anderes übrig, als das innere Auge auf die Betrachtung ewiger Dinge zu richten. Und ich laufe noch immer hinter diesem Trugbild der sogenannten Achtung der Welt her! O die menschliche Eitelkeit! Ich weiß wohl, daß ich eine gute Entschuldigung habe: die Sache der Freiheit. Aber man müßte sie innerlich philosophisch erworben haben, bevor man sie von den Tyrannen verlangt.
In unserer Zukunft – wenn anders es uns beschieden ist, noch einige Zeit miteinander zu leben, fürchte ich Ihre plötzlich wiederkehrenden phantastischen Launen. Jetzt vermissen Sie mich, und es sieht so aus, als ob ich Ihnen wirklich fehle; wenn ich aber wieder da bin, werden Sie mich abermals mürrisch, schwierig, unerträglich finden – Sie werden mir wieder wie früher meine inneren Qualen als Fehler anrechnen und mich deshalb mit Vorwürfen überhäufen.
Am 4. August. Ich habe mich vorgestern hierher begeben, weil man Walwen in Mecklenburg als ersten Sammelplatz nannte und Demmin auf halbem Wege zwischen Stralsund und dort liegt. Das ganze Gefolge des Prinzen, das hinten geblichen war, setzte sich gleichfalls in Bewegung. Gestern nun kamen Herr von Wetterstedt und Adlercreutz; ich habe mit ihnen bei Marschall Stedingk, der hier sein Hauptquartier hat, zu Mittag gegessen. Sie haben den Prinzen in Strelitz verlassen; von dort hat er mit nur einigen Adjutanten seinen Weg in Richtung auf die Niederelbe nach Grabow fortgesetzt, und von da kommt er über Wismar-Stralsund zurück. Ich werde also auch dorthin zurückkehren – alles ist verändert, und das Hauptquartier wird auf einmal gewaltig nach vorn verlegt, und zwar zwischen Berlin und die Elbe. Oranienburg und Potsdam werden als die Hauptzentren genannt. Nach dem, was ich gestern erfuhr, glaube ich nun ganz und gar an den Krieg. Bonap[arte] scheint Österreich und seine Vermittlung mit der größten Unverschämtheit zu behandeln. Bis jetzt waren noch keine Bevollmächtigten am Kongreßort erschienen, denn Herr von Narbonne hat keine Vollmachten und macht nur schöne Redensarten. Caulaincourt erwartete man vergebens, und die Unterhändler der Verbündeten konnten in aller Ruhe Maulaffen feilhalten. Aber was allem die Krone aufsetzt: Bonap[arte] hat in Prag Fouché als neuen ›Statthalter der Illyrischen Provinzen‹ auftreten lassen. Das ist nun wirklich eine Beschimpfung, denn die Illyrischen Provinzen sind das erste, was Österreich zurückhaben muß. Er hat den Waffenstillstand brechen wollen, weil die Preußen die Festungen nicht so verproviantierten, wie er es forderte; davon hat er dann aber auf die Erklärung Österreichs hin Abstand genommen, es würde das als Signal zum Kriege auffassen. Sie haben von der Schandtat der Franzosen gegen das Lützowsche Freikorps erfahren, das sie mitten während des Waffenstillstands überrumpelt haben. Aber sein tapferer Befehlshaber, der ihnen glücklicherweise entgangen ist, hat sich dadurch nicht entmutigen lassen; er hat sein Korps auf 3000 Mann verstärkt, die sich alle auf eigene Kosten oder durch patriotische Gaben unterhalten und ausrüsten, ohne daß es den Staat etwas kostet. Der Prinz hat Herrn von Lützow den Schwertorden verliehen. Die Schweden sind ganz entzückt von dem Empfang zurückgekommen, den sie in Berlin und überall fanden. Man hat dem Prinzen lebhafteste Beweise der Begeisterung entgegengebracht. Der schwedische Soldat seinerseits lebt in guter Freundschaft mit unsern Bürgern und Bauern; er genießt dankbar ihre Gastfreundschaft und hilft ihnen bei der Arbeit. Allerdings haben die Franzosen jedem, der nach ihnen kommt, es leicht gemacht, sich gut zu führen. In Hamburg und Lübeck begehen die Henker des Tyrannen alle erdenklichen Schandtaten: sie verschleppen die Kinder bis ins Innere Frankreichs unter dem Vorgeben, sie wollten sie zu Seeleuten machen – in Wahrheit sollen sie ihnen als Geiseln dienen. Warum könnte Lord Wellington nicht in Bayonne und überall, wohin er kommt, Vergeltung üben? Man läßt Frauen der Gesellschaft an den Befestigungen arbeiten und ebenso Greise, die patriotische Gesinnung bekundet haben. Erzählen Sie das doch Lord Holland, der den Grundsatz der Unverletzbarkeit des französischen Kaiserreichs vertreten hat! Und dies Gesindel maßt sich noch den Namen einer ehemals ehrenhaften Nation an! Ach! Wie wünschte ich, daß der Tag der Rache endlich käme! Herr von Wallmoden wird auf jenem Flügel und gegen meine Freunde, die Dänen, kommandieren. Die Holsteiner aber hoffen wir auf unsere Seite ziehen zu können; ich habe sie schon lebhaft dazu angespornt, und man versichert mir, daß das ganz bestimmt seine Wirkung tun wird.
Sollte der Feldzug wieder beginnen, so wird er rasend schnell und fürchtersich sein – daran ist kein Zweifel. In wenig Wochen wird unser Schicksal so oder so entschieden sein. Wahrscheinlich will Bonap[arte], solange ihm die Verbündeten Spielraum lassen, zuerst einen großen Schlag gegen die schwedische Armee führen, aber sie ist vorbereitet, ihn gut zu empfangen. Die schwedische Infanterie ist ausgezeichnet; sie wird Wunder mit dem Bajonett vollbringen. Allerdings haben sie wenig Kavallerie, aber die fremden Korps, die der Prinz kommandiert, gleichen das reichlich aus. Die aktive Feldartillerie, die er zu seiner Verfügung hat, beläuft sich auf etwa 300 Kanonen – die englische ist noch nicht angekommen. Die deutsche Legion hat Kanonen mit guter russischer Bespannung mitgebracht.
In diesem Augenblick ist vielleicht Moreau schon in Stralsund; ich bin neugierig, wohin sein Weg ihn noch führen wird.
Liebe Freundin! Während dieser Ruhepause suche ich in meinem Brief alle Themen zu erschöpfen, denn in der Folgezeit könnte ich mich leicht auf einige in aller Eile hingeworfene Zeilen beschränken müssen. Ich will Ihnen also noch einiges über mehrere Freunde und Bekannte schreiben.
Herr von Balk ist im vergangenen Herbst über Odessa nach Konstantinopel gefahren; der Pest wegen hat er immer in Bujükderc gewohnt, und General Tawast hat ihn letzthin bei guter Gesundheit verlassen; er schmiedete große Reisepläne.
Graf Baudissin ist es gelungen, einen Brief aus seinem Gefängnis in der Festung Friedrichsort bei Kiel an mich gelangen zu lassen. Ich werde Ihnen diesen Brief schicken, sobald ich ihn dem Prinzen gezeigt habe. Sein Verhalten ist vornehm und bestimmt – er hat uns vollauf gerechtfertigt. – Rührt das nicht Albertines Herz? Er bleibt dort ein Jahr, wenn wir ihn nicht befreien. Aus solchem Gefängnis muß man als Staatsminister herauskommen.
Ich möchte Ihnen ebensoviel von dem armen Sabran erzählen können. Wir haben keine Verbindung mit Frankreich, aber nach allem, was ich höre, ist er immer noch im Gefängnis, und nicht nur er, sondern etwa zwanzig andere Personen sind durch die Papiere bloßgestellt, die die Polizei bei ihm beschlagnahmt hat. Man erzählt allgemein, daß ein Brief von Ihnen auf ihn aufmerksam gemacht hat; ich glaube das nicht, denn ich bin sicher, daß Sie mit der größten Vorsicht geschrieben haben. Das muß Sie aber zu dem unerschütterlichen Entschluß bringen, niemals an irgendwen in Frankreich auch nur eine einzige Zeile zu schreiben. Wenn es sich um Geschäfte handelt, so kann man Bankiers damit beauftragen. Diese Ratschläge habe ich von einer Genferin, der Gouvernante bei der kleinen Prinzessin von Mecklenburg. Legen Sie das auch bitte August ans Herz, damit er nicht das Schicksal seiner Freunde, soweit sie im modernen Babylon geblieben sind, verschlimmert. Es muß so aussehen, als ob er sie vergessen habe. Das ist grausam, aber notwendig.
Ich habe einen Brief vom Grafen von Gröben erhalten: er schreibt mir, er habe schon an neunzehn mehr oder minder blutigen Kämpfen teilgenommen, und er brennt darauf, sich von neuem zu schlagen. Er ist bei der Hauptarmee – überall, wo er war, hat er sich einen glänzenden Ruf erworben. Er erkundigt sich rührend sorglich nach dem Schicksal eines gewissen Ekendhal, den er an uns empfohlen hatte; auf der anderen Seite ist Ekendhal voll lebhaftester Dankbarkeit gegen Sie und mich: er steht in einem neugebildeten Korps, das England besoldet.
Schelling hat sich vor mehr als einem halben Jahr mit Fräulein Gotter, der Tochter eines recht bekannten Dichters, wieder verheiratet. Diese Heirat hat alte Erinnerungen in mir wachgerufen: die junge Frau war Augustas Spielgefährtin; sie hat einige Zeit in meinem Hause verbracht, und Frau Schelling betreute sie mütterlich. Ich sehe in dieser Wahl einen Beweis dafür, daß Schelling recht gefühlvoll ist – ich hätte ihn dessen nicht für fähig gehalten.
Der Dichter Tieck hat mir mit sehr liebenswürdigen Worten ein Werk gewidmet. Ich wußte garnichts davon, bis es mir bei meiner Ankunft in Deutschland in die Hände fiel. Es heißt Phantasus und ist eine Sammlung seiner teils dialogisierten, teils erzählenden alten und neuen Schriften – alles dies in eine Rahmenerzählung nach Art des Dekameron gespannt, aber mit modernen Ideen und Formen. Tiecks Prosa ist anmutig und reizvoll. Ich könnte mir denken, daß mehrere seiner Erzählungen, gut übersetzt, in England einen tollen Erfolg haben müßten; eine, Der Liebeszauber ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk in seiner grausigen Phantastik.
Im übrigen erhalte ich Nachrichten von unseren alten Freunden, die mir beweisen, daß ich der Zeit besser getrotzt habe als die meisten von ihnen. Tieck soll ganz gebeugt und jung nur das Feuer seiner Augen und seine sprühende Redeweise geblieben sein. Fichtes linker Arm ist infolge einer Krankheit verschrumpft; die schwache Hand ist zur Untätigkeit verdammt, während der Zeigefinger der rechten Hand wie früher seine Kraft dadurch beweist, daß er mit erbarmungslosem Nachdruck den Vortrag begleitet. Im übrigen lebt Fichte in Berlin gänzlich unbeachtet.
Herr von Wetterstedt hat die Gräfin von Voß am Strelitzer Hof getroffen, und sie hat ihn beauftragt, mich auf ihren Landsitz einzuladen; aber dazu brauche ich mehr Zeit und Ruhe. Frau Bethmann hat mich auch eingeladen, bei ihr in Berlin zu wohnen – für den Fall, daß ich dorthin komme. Man hat mich also doch nicht ganz vergessen.
Es ist sehr gütig von Ihnen, an die Sicherstellung meiner Zukunft in England zu denken, aber ich bitte Sie, noch keine Schritte zu unternehmen; ich habe eine Abneigung gegen Gesuche, die sich nicht auf reine Ehrenauszeichnungen beziehen. Auch muß ich mich als zur Umgebung des Kr[on]pr[inzen] gehörig betrachten. Wenn er in seinen Unternehmungen Erfolg hat und ich imstande bin, ihm Dienste zu erweisen, wird er nicht vergessen, mich zu belohnen. Übrigens bin ich mein ganzes Leben hindurch arm gewesen und werde es, wie ich glaube, auch bleiben. Das steht in meinen Sternen geschrieben.
Es läge mir mehr daran, meinen Bruder aus seiner jetzigen Stellung zu befreien, in der sein Verdienst nicht so anerkannt wird, wie es eigentlich sein müßte. Ich würde ihn gern in England an einem Institut für orientalische Studien untergebracht sehen. Leider spricht er sehr schlecht englisch, und in seinem Alter lernt es sich schwer. So wird er denn weiter in Wien vegetieren, und wir werden wahrscheinlich für immer voneinander getrennt bleiben.
Was Sie mir über den Erfolg meiner Schriften in England mitteilen, ist mir sehr angenehm. Ich habe den Gedanken, dort meine Comparaison des deux Phèdres neu drucken zu lassen. In derselben Absicht habe ich Ihre Schrift über den Selbstmord nach Berlin geschickt, weil eine deutsche Übersetzung davon herauskommen soll. Hoffentlich macht mir die Zensur keine Schwierigkeiten wie bei meinen Betrachtungen über die dänische Politik. Sie haben den Druck der französischen Übersetzung verweigert, weil bei der Besprechung der dänischen Reg[ierung] der Despotismus im allgemeinen nicht gut wegkommt. Was sagen Sie dazu? Die öffentliche Meinung in Preußen ist heute ausgezeichnet – alle Welt bestätigt das – aber die Anschauungen der Regierung sind nicht auf der Höhe der Zeit – weit gefehlt! Noch immer zeigt sie die gleichen Schwächen und Schwankungen, die die Monarchie zugrunde gerichtet haben, und wenn die nationale Bewegung sich durchsetzt, so muß sie von Grund auf umgemodelt werden. Ich könnte mich Ihnen gegenüber auf die Zeugenschaft von Leuten berufen, die die Dinge aus der Nähe mitangesehen haben. Ich gebe gern zu, daß es in Österreich ebenso steht. Allgemein gesagt: Erst wenn das Ungeheuer niedergeworfen ist, beginnt die wahre, schwerste Arbeit: uns zu einer Nation zu formen.
Was ist denn eigentlich aus der Bücherkiste geworden, die Sie einpacken ließen, um sie – es ist schon sehr lange her – nach England zu schicken? Alle Ihre Schriften und die Ihres Vaters waren darin – die meinen auch; es wäre gut, sie zu haben, indessen kann man sich damit nicht überall herumschleppen.
Der Verleger Perthes hat sich aus Hamburg gerettet. Er hat durch seine Achtung sein ganzes Vermögen verloren, aber er trägt das als frommer Mann, der er ist. Wenn sein Vaterland nicht frei wird, will er nach England übersiedeln. Mit seinem Fleiß und den zuverlässigen Kenntnissen, die er besitzt, könnte sein Verlagsunternehmen ein Mittel zur Wiederbelebung des literarischen Verkehrs zwischen England und dem Kontinent werden. Jedenfalls ist er ein Mann, den man unter allen Umständen unterstützen muß. Dieser elende König von Westfalen hat soeben die Hallenser Universität geschlossen, weil sie sich zum Vaterlande bekannte. Was soll aus Deutschland werden, wenn es sich nicht bald in seiner Gesamtheit erhebt, um dieses Gezücht zu vernichten? Ich kehre morgen nach Stralsund zurück, weil ich den Pr[inzen] noch vor unserer großen Abfahrt sprechen will. Die Grafen von Brahe und Gyllenskjöld kommen soeben durch. Der Pr[inz] hat den ersten abgesandt, um Moreau offiziell zu begrüßen, falls er schon angekommen ist. Herr von Noailles, der Alberts Kamerad geworden war, wie Sie wissen, wird viel zur Nachrichtenübermittelung gebraucht; ich denke, daß er seinen Weg gut machen wird.
Pozzo di Borgo ist seit der Konferenz, zu der er vor dem Kr[on]pr[inzen] angekommen ist, beim Kaiser von Rußland geblieben und dort General geworden. Seine Ratschläge und seine Willenskraft können dort drüben sehr nützlich sein. Wenn man Frieden schließt, denke ich, wird er nach England zurückkehren und dann wohl zu Ihrem Kreis gehören. Dann können Sie im Salon weiter mit ihm lebhaft diskutieren; ich wenigstens stritt mich mit ihm, solange wir uns täglich hier sahen, immer herum – und zwar auf allen Gebieten, außer dem politischen. Hoffentlich wird er einmal seine Denkwürdigkeiten schreiben.
Dieser Brief steht im Zeichen des Waffenstillstandes, und ich glaube, ich schließe ihn erst ab, wenn dieser zu Ende ist. Es ist wirklich ein jämmerliches Gefühl, in einer kleinen Stadt zu sitzen, wo man niemand kennt, fern von seinem gewohnten Kreise; Bücher kann man sich nicht beschaffen und bei dem schlechten Wetter kann man noch nicht einmal in der Umgebung herumstreifen. Im allgemeinen bin ich so teilnahmlos, daß ich eines starken Antriebs von außen bedarf. Ich muß z. B., um ein Buch hintereinanderweg zu lesen, noch 40000 vor mir sehen. Aber das Leben ist mir so gleichgültig, daß ich sogar die Langeweile über mich kommen lasse, ohne mir auch nur die geringste Mühe zu geben, mich zu zerstreuen – es ist mir schon zu oft mißlungen.